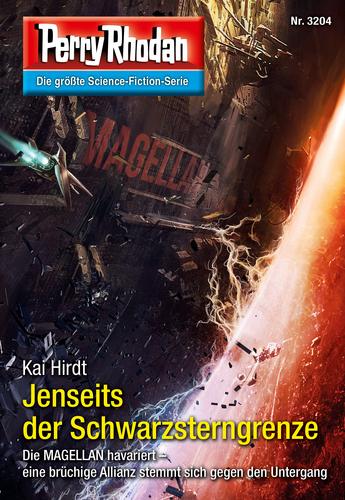Der PERRY RHODAN-Report 563 wurde in PERRY RHODAN-Band 3204 (»Jenseits der Schwarzsterngrenze« von Kai Hirdt) veröffentlicht. Die redaktionelle Beilage widmete sich der Arbeit von Autorinnen und Autoren im Verlauf der Zeit.
Ein Artikel stammt von Falk-Ingo Klee, der für die ATLAN-Serie schrieb und mehrere PERRY RHODAN-Taschenbücher verfasste. Wir dokumentieren ihn an dieser Stelle als eine eigenständige Kolumne.
Als die Löschtaste noch Radiergummi hieß
Sieht man sich einen PERRY RHODAN-Roman an, findet man zu früher kaum Unterschiede. Gut, er kostet Euro anstatt DM, Johnny Bruck hat das Titelbild nicht mehr gemalt und der Name des Autors ist mittlerweile auf dem Cover aufgedruckt, aber sonst?
Gleiches Format, immer noch in Heftform und mit dem gleichen Umfang. Rund 200.000 Anschläge. Das wissen die Autoren von heute, und das wussten die Autoren von früher. Gibt es denn überhaupt einen Unterschied?
Ja. Damals war am Anfang ein weißes Blatt. Es grinste den Autor höhnisch an, der davor saß und auf eine innere Eingebung wartete. Das Schreibgerät seinerseits wartete darauf, dass der erste Buchstabe endlich auf das eingespannte Papier gehämmert wurde, während das weiße Blatt darauf lauerte, dass gleich die erste betätigte Taste einen Tippfehler produzierte. Dann hatte es nämlich schon Feierabend, wurde zerknüllt und nicht mehr weiter gequält.
Dem Schreibgerät wiederum war das völlig egal, es empfand keinerlei Spannung, es stand nicht einmal unter Strom, denn es funktionierte ohne elektrische Energie rein mechanisch, wohnte in einem eigenen kleinen Koffer und nannte sich Reiseschreibmaschine. Ach ja, es war halt die gute alte Zeit …
Von wegen »gute alte Zeit« und Schriftsteller-Romantik! Hinter dem höhnisch grinsenden Blatt Papier lauerten Verbündete des Grinsers: drei Blätter dünnes, pergamentpapierähnliches Durchschlagpapier, jeweils getrennt durch ein Blatt Kohlepapier. Ein solcher Aufbau, säuberlich geschichtet wie eine Lasagne, verbarg sich hinter jedem weißen Blatt, das ins Schreibgerät eingespannt war und das es zu beschriften galt. Und es waren viele Blätter. Es war Autorenquälerei, also Haltungsstufe Null.
Lektor ohne Erbarmen
Der damalige Lektor Günter M. Schelwokat (laut Ernst Vlcek der »Sadist von Straubing«) pochte darauf, Manuskripte zu bekommen, die nichts weiter enthielten als weiße Blätter mit schwarzen Buchstaben darauf, und jede Seite genormt – 40 Zeilen (Abstand eineinhalbzeilig) à 60 Anschläge. Was laut dem immer noch berühmten Adam Riese 2400 Buchstaben und Zeichen pro Blatt ergibt. Wer einen Master in Mathe hat oder einen Taschenrechner besitzt, kann ja jetzt selbst ermitteln, welchen Umfang ein 200.000-Anschläge-Manuskript besitzt.
Schelwokats Doktrin: kein Durchixen, kein Durchstreichen, kein Überschreiben, keine handschriftlichen Korrekturen und kein Gebrauch von Radiergummi. Das hieß: Tippfehler in der letzten Zeile im letzten Wort – ab in den Papierkorb, die Seite neu schreiben! Ja, dafür liebte man GMS, wie Schelwokat kurz genannt wurde. Wer jetzt »Tipp-ex«, »Korrekturflüssigkeit« oder »Lift-Off-Korrekturband« ruft – setzen, das gibt einen Eintrag im Klassenbuch! Denn das alles kam erst später. Doch auch dann war es nicht wirklich hilfreich, denn durch den Einsatz dieser Hilfsmittel wurden ja die Durchschläge unleserlich.
Was hatte es mit denen eigentlich auf sich? Das Original ging an den Verlag für das Lektorat, sprich GMS, der nicht in Rastatt arbeitete, sondern als Außenlektor in Straubing schon damals im Homeoffice tätig war – was ja eigentlich klar ist, schließlich ging es um SF, also um Zukunft. Eine Kopie, sprich Durchschlag, ging an den Exposéautor, ein weiterer an den Autorenkollegen, der den Folgeroman schrieb, und das dritte Exemplar blieb zum Selbstbehalt beim Autor.
Hatte der nebenberufliche Autor – etwa ein Mensch wie ich – dann nach Feierabend und an den Wochenenden das Manuskript im Schweiße seines Angesichts innerhalb der sechswöchigen Abgabefrist glücklich vollendet und endlich verschickt, meldete sich nach einiger Zeit am frühen Abend – man ahnte nichts Böses, das Wählscheibentelefon besaß ja kein Display – eine akzentfreie Stimme. Es war GMS, der Sadist von Straubing, oder wie ich ihn einmal in einer Kolumne genannt habe: der organische Duden. Akribisch wurde jeder Tipp-, Rechtschreib- und Interpunktionsfehler mit gesprochenem streng erhobenen Zeigefinger angemerkt und erläutert, verbunden mit der Ermahnung, in Zukunft genauer darauf zu achten.
Ach, was war es für eine glückliche Zeit! Das Honorar war nicht üppig, aber man hatte viele kleine Positionen, die man steuerlich absetzen konnte. Natürlich Schreibmaschinenpapier, Kohle- und Durchschlagpapier, Farbbänder für die Schreibmaschine, Schnellhefter für die Kopien, die verschickt werden mussten, Briefumschläge und Porto. Die Telefongebühren waren hoch, insbesondere bei Ferngesprächen, und bei Freizeitautoren strichen die Finanzbehörden sie als private Aufwendungen milde lächelnd weg.
Nun habe ich mehrmals das Wort »Schreibmaschine« erwähnt, ein Begriff, den heutzutage kaum noch jemand kennt. Also sehe ich mich genötigt, dieses Schreibgerät kurz zu erläutern. Im Prinzip ist es eine Tastatur, die dank etwas schwergängiger Mechanik für schmerzende Knöchel und überbeanspruchte Finger sorgt, also ein steter Born der Freude ist, wann immer man sich daran betätigen darf. Ist es erwähnenswert, dass ich der Kunst des Maschineschreibens nicht mächtig war und zur Schonung der schwächeren Greifinstrumente nur die beiden Zeigefinger einsetze? Die Schreibmaschine zeigte sich davon jedenfalls sehr beeindruckt, so kraftvoll gefordert zu werden.
Schreibmaschinen hatten noch Charakter, bestand ein wichtiger Teil von ihnen doch aus echten Typen, also genauer gesagt aus metallenen Typenhebeln. An deren oberen Ende saßen Buchstaben, die bei beim kräftigen Tastenanschlag das Farbband derartig druckvoll gegen das Papier hämmerten, dass auf selbiges ein Buchstabe gedruckt wurde; ein Schöpfungsakt, den man als Zehn-Finger-Schreiber – also im Gegensatz zu mir – überhaupt nicht mehr wahrnahm. Bei mir dagegegen war jede Taste eine Entdeckung.
Was außerdem bei Schreibmaschinen nachteilig war – sie wurden ohne eingebautes Rechtschreibprogramm geliefert. Das musste man sich extra kaufen, und es hatte sogar einen eigenen Namen: Duden. Das Duden-Programm gab es auch nicht als Diskette oder CD oder DVD, sondern nur gedruckt. Anfangs leistete ich mir nur das einbändige Werk, dann packte mich der Ehrgeiz, es GMS zu zeigen, und ich stellte mir das sechs Bände umfassende Werk ins Regal. Keine Chance, GMS hatte bestimmt eine dreißigbändige Prachthausausgabe zu Hause stehen, denn er fand immer mindestens fünf Fehler mehr als ich.
Natürlich gab es auch damals schon für jeden Heftroman ein Exposé. Es umfasste so fünf, sechs Seiten und gab den Handlungsverlauf und auch die Personen vor, die als Handlungsträger bereits vorher bekannt waren oder neu agieren sollten. Ja, und dann hieß es für den Autor wie in Schillers Glocke: »Frisch, Gesellen, seid zur Hand!«
Und in Zukunft? Da braucht man als Autor eigentlich gar nichts mehr zu machen. Man gibt seiner PC-KI die Vollmacht für seinen Mail-Account, die checkt die Exposé-Eingänge, schreibt dann über Nacht das Manuskript, schickt es am nächsten Tag als fertige Datei per Mail an die Redaktions-KI in Rastatt, die sagt der eigenen KI dann, was sie noch am Text verbessern muss, und veranlasst nach Eingang der Textkorrektur die Zahlung. Dann hat man als Autor quasi für null Arbeit viel Geld gekriegt!
Ach ja, Autor der Zukunft müsste man sein. Allerdings könnte es auch passieren, dass Verlage Retro-SF-Serien verlegen möchten. Und damit das alles stilgerecht geschieht, müssen die Manuskripte mit jeweils drei Durchschlägen wieder auf der Schreibmaschine geschrieben werden.
Ich weiß ja, wie es geht, aber keine Bange, liebe Perryversum-Kollegen, ich mach’s nicht mehr …